Geld, Macht und Gesellschaft in den langen Wellen der Geschichte
In einer früheren Analyse haben wir technologische Revolutionen als den primären Motor der langen ökonomischen Wellen, bekannt als Kondratjew-Zyklen, identifiziert. Die Dampfmaschine, Eisenbahnen, Elektrizität und der Mikrochip waren allesamt grundlegende Innovationen, die die Weltwirtschaft in wiederkehrenden Zyklen von 50 bis 60 Jahren umgestalteten. Diese technologiezentrierte Sichtweise erzählt jedoch nur einen Teil der Geschichte – wenn auch einen spektakulären. Hinter den Kulissen wirken andere, ebenso mächtige Kräfte: der Fluss des Finanzkapitals, die wechselnden Gezeiten der sozialen Stimmung und die Neuausrichtung der globalen Macht.
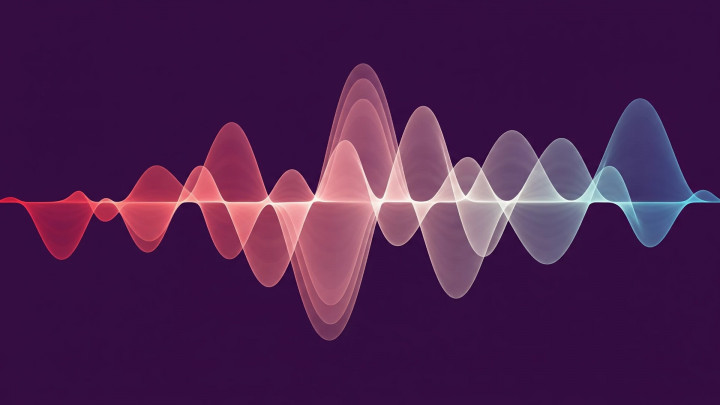
Dieser Artikel taucht in diese verborgenen Dimensionen der Kondratjew-Wellen ein und untersucht, wie technologische Innovation mit Finanzspekulation verknüpft ist, wie wirtschaftliche „Jahreszeiten“ sich in unserer Politik und Gesellschaft widerspiegeln und wie jede neue Welle die geopolitische Weltkarte neu zeichnen kann.
Der Doppeltanz des Finanzkapitals: Schöpfung und Zerstörung
Eine technologische Revolution geschieht nicht im luftleeren Raum. Damit eine vielversprechende Erfindung zu einer Kraft wird, die die gesamte Wirtschaft transformiert, bedarf es einer massiven Kapitalzufuhr. Hier kommt der Finanzkapitalismus ins Spiel, dessen Rolle die neo-schumpeterianische Ökonomin Carlota Perez am lebhaftesten beschrieben hat. In ihrem Modell ist jede lange Welle in zwei Hauptperioden unterteilt: die Installationsphase und die Einsatzphase, getrennt durch einen kritischen Wendepunkt – typischerweise einen großen Finanzcrash.
- Die Installationsphase: Wenn ein neues technologisches Paradigma entsteht (wie das Internet in den 1990er Jahren), stürzt sich Finanzkapital – spekulatives Geld, das schnelle, hohe Renditen sucht – darauf. Dies ist der „Frühling“ und „Sommer“ des Zyklus: eine Art Goldrausch, bei dem Investoren rücksichtslos Geld in Start-ups im Zusammenhang mit der neuen Technologie pumpen, oft ohne Rücksicht auf stabile Geschäftsmodelle oder tatsächliche Einnahmen. Wir sahen dies während der Dotcom-Blase der späten 1990er Jahre. Die Luft ist erfüllt von Optimismus, doch diese Phase ist auch der Beginn der „kreativen Zerstörung“, da die neue Technologie beginnt, alte Industrien zu bedrohen. Unweigerlich führt dieser Spekulationsrausch zu einer Blase.
- Der Wendepunkt: Schließlich platzt die Blase. Der Dotcom-Crash von 2000 und die noch größere Finanzkrise von 2008 sind perfekte Beispiele für diesen Wendepunkt. Diese Krisen sind unglaublich schmerzhaft, aber laut Perez auch notwendig. Sie bereinigen den Markt von nicht überlebensfähigen Unternehmen und zwingen Investoren zu einem „Reality Check“. Der Crash wirkt wie ein Schmelztiegel, der eine reifere Technologie für die weitreichende, praktische Anwendung schmiedet.
- Die Einsatzphase: Nach der Krise verlagert sich der Fokus von Spekulation auf Produktion. Produktionskapital (Geld, das in Fabriken, Infrastruktur und reale Produkte investiert wird) übernimmt die Führung. Die Technologie ist nicht länger nur ein Versprechen; sie wird in den Kern der Wirtschaft integriert. In dieser Phase werden die großen, stabilen Unternehmen aufgebaut (denken Sie in unserer Ära an Google, Amazon und Apple), und die Vorteile der Technologie beginnen sich auf breitere Gesellschaftsschichten auszubreiten. Diese Phase repräsentiert den „Spätsommer“ und „Herbst“ des Zyklus – ein „goldenes Zeitalter“ des Wohlstands und der Stabilität, das schließlich zu Marktsättigung und verlangsamtem Wachstum führt und die Bühne für den nächsten „Winter“ bereitet.
Dieses Modell erklärt, warum große Technologiesprünge so oft untrennbar mit scheinbar irrationalen Finanzblasen und den darauf folgenden verheerenden Crashs verbunden sind.
Ein Spiegel der Gesellschaft: Wirtschaftliche Jahreszeiten und politische Stürme
Kondratjew-Wellen hinterlassen nicht nur Spuren in Wirtschaftscharts; sie beeinflussen zutiefst die soziale Stimmung und die politische Dynamik. Die wirtschaftlichen „Jahreszeiten“ spiegeln sich fast perfekt in der kollektiven Psyche wider.
- Frühling und Sommer: Die frühen Phasen des Zyklus sind durch sozialen Optimismus gekennzeichnet. Es herrscht ein weit verbreiteter Glaube an Fortschritt, und soziale Mobilität – der Traum vom Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär – fühlt sich wie eine greifbare Möglichkeit an. Eine wachsende Wirtschaft stärkt die Mittelschicht, was typischerweise politische Stabilität fördert. Debatten drehen sich meist darum, wie der wachsende Kuchen verteilt werden soll, nicht darum, die Grundlagen des Systems selbst in Frage zu stellen. Denken Sie an die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Welt.
- Herbst und Winter: Wenn der Zyklus reift und in seine Endphasen eintritt, verlangsamt sich das Wachstum, Märkte sättigen sich und Gewinnmargen schrumpfen. Unternehmen konzentrieren sich auf Kostensenkungen und Effizienz, was oft zu Arbeitsplatzverlusten und Lohnstagnation führt. Gleichzeitig übersteigen die Kapitalrenditen oft das Wirtschaftswachstum, was zu einer dramatischen Zunahme der sozialen Ungleichheit führt. Die Menschen beginnen das Gefühl zu haben, dass das „Spiel manipuliert“ ist und der Gesellschaftsvertrag gebrochen wurde. Dies führt zu einer Ära von Pessimismus, Misstrauen und Wut, die einen fruchtbaren Boden für populistische Bewegungen, politische Polarisierung und radikale Herausforderungen des Status quo bietet. Die aktuellen politischen Spannungen, die Gegenreaktion auf die Globalisierung und die Erosion des Vertrauens in demokratische Institutionen im gesamten Westen sind keine zufälligen Ereignisse; sie sind klassische Symptome eines Kondratjew-Winters.
Die Gezeiten der Hegemonie: Geopolitische Verschiebungen
Die Auswirkungen der Kondratjew-Wellen sind auch auf internationaler Ebene spürbar. Historisch gesehen steigt die Nation, die die Technologie einer neuen Welle am erfolgreichsten beherrscht und einsetzt, oft zu einer Position globaler Hegemonie auf. Das neue technologische Paradigma ermöglicht nicht nur wirtschaftliche Dominanz, sondern auch militärische und kulturelle Überlegenheit.
- Die Erste und Zweite Welle (Dampf, Eisenbahn) fielen mit dem Aufstieg Großbritanniens zusammen. Seine Fabriken, seine Marine und sein globales Handelsnetzwerk machten es zur unangefochtenen dominanten Macht des 19. Jahrhunderts.
- Die Dritte, Vierte und Fünfte Welle (Elektrizität, Öl, Automobil, Informationstechnologie) leiteten die Dominanz der Vereinigten Staaten ein. Amerikanische Massenproduktion, technologische Innovation (Silicon Valley) und Finanzkraft (Wall Street) machten das 20. Jahrhundert zum „amerikanischen Jahrhundert“.
Dies wirft eine der kritischsten geopolitischen Fragen unserer Zeit auf: Wer wird die Sechste Welle anführen? Während Prognosen ein riskantes Geschäft sind, deuten die Anzeichen eindeutig auf einen neuen Wettstreit um die technologische Führung hin.
- China unternimmt eine gezielte, staatlich finanzierte Anstrengung, um die Schlüsseltechnologien der Sechsten Welle zu dominieren, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz, grüne Energie und Biotechnologie. Pekings Ambition ist nichts Geringeres, als die amerikanische technologische Hegemonie zu brechen.
- Die Vereinigten Staaten verfügen jedoch immer noch über eine außergewöhnliche Innovationsfähigkeit und bleiben an der Spitze vieler grundlegender Technologien. Der Ausgang dieses Wettbewerbs ist noch lange nicht entschieden.
Einige Analysten deuten vorsichtig an, dass die Sechste Welle möglicherweise keinen einzelnen Hegemon hervorbringt, sondern stattdessen eine multipolare Weltordnung fördert, mit mehreren Zentren technologischer und wirtschaftlicher Macht, die miteinander konkurrieren und zusammenarbeiten. Diese geopolitische Neuausrichtung dürfte eine der prägenden Geschichten des 21. Jahrhunderts sein.
Fazit
Das Verständnis der Kondratjew-Wellen führt uns über eine einfache Analyse von Technologie und Wirtschaft hinaus. Es bietet eine mächtige Linse, durch die wir die tiefsten sozialen Spannungen und geopolitischen Verschiebungen unserer Zeit betrachten können. Die Euphorie und Panik der Finanzmärkte, der Anstieg der politischen Polarisierung und der Wettbewerb zwischen Großmächten sind keine isolierten Ereignisse, sondern Teile eines größeren, zyklischen Musters. Die Unsicherheit und Turbulenzen unseres aktuellen „Winters“ könnten durchaus die unvermeidlichen Wachstumsschmerzen einer neuen techno-ökonomischen Ära sein. Dieses Muster zu erkennen, liefert keine einfachen Antworten, aber es hilft uns, die richtigen Fragen zu stellen, während wir an der Schwelle zur nächsten großen Welle der Geschichte stehen.





